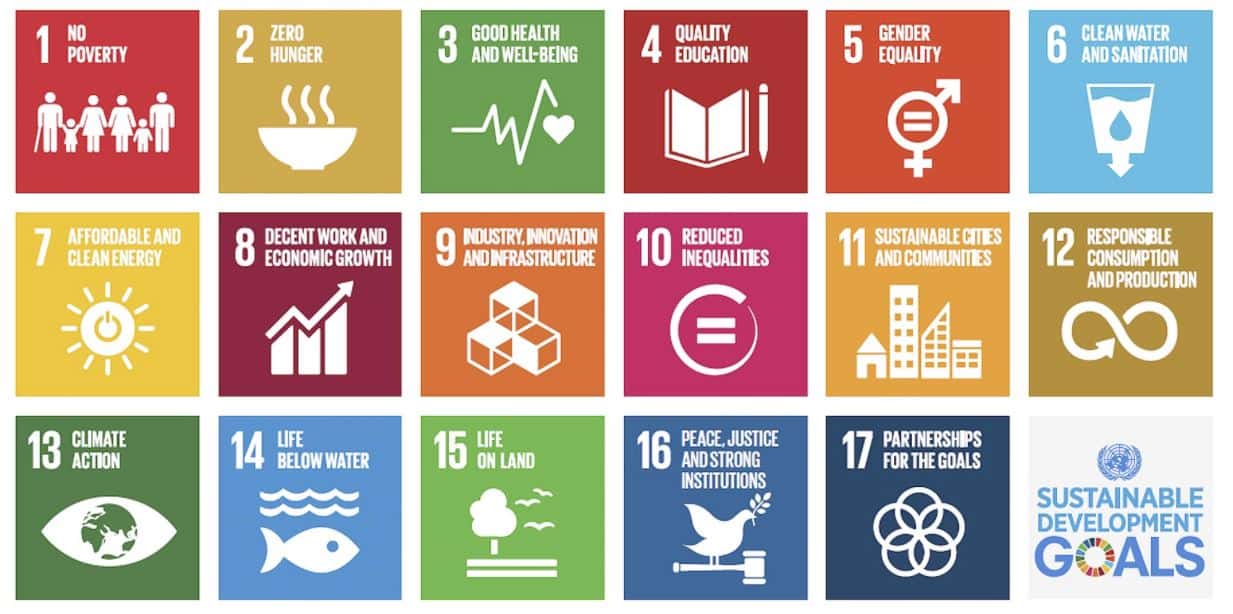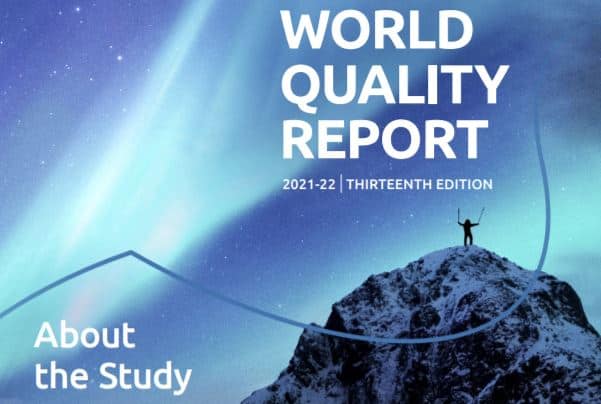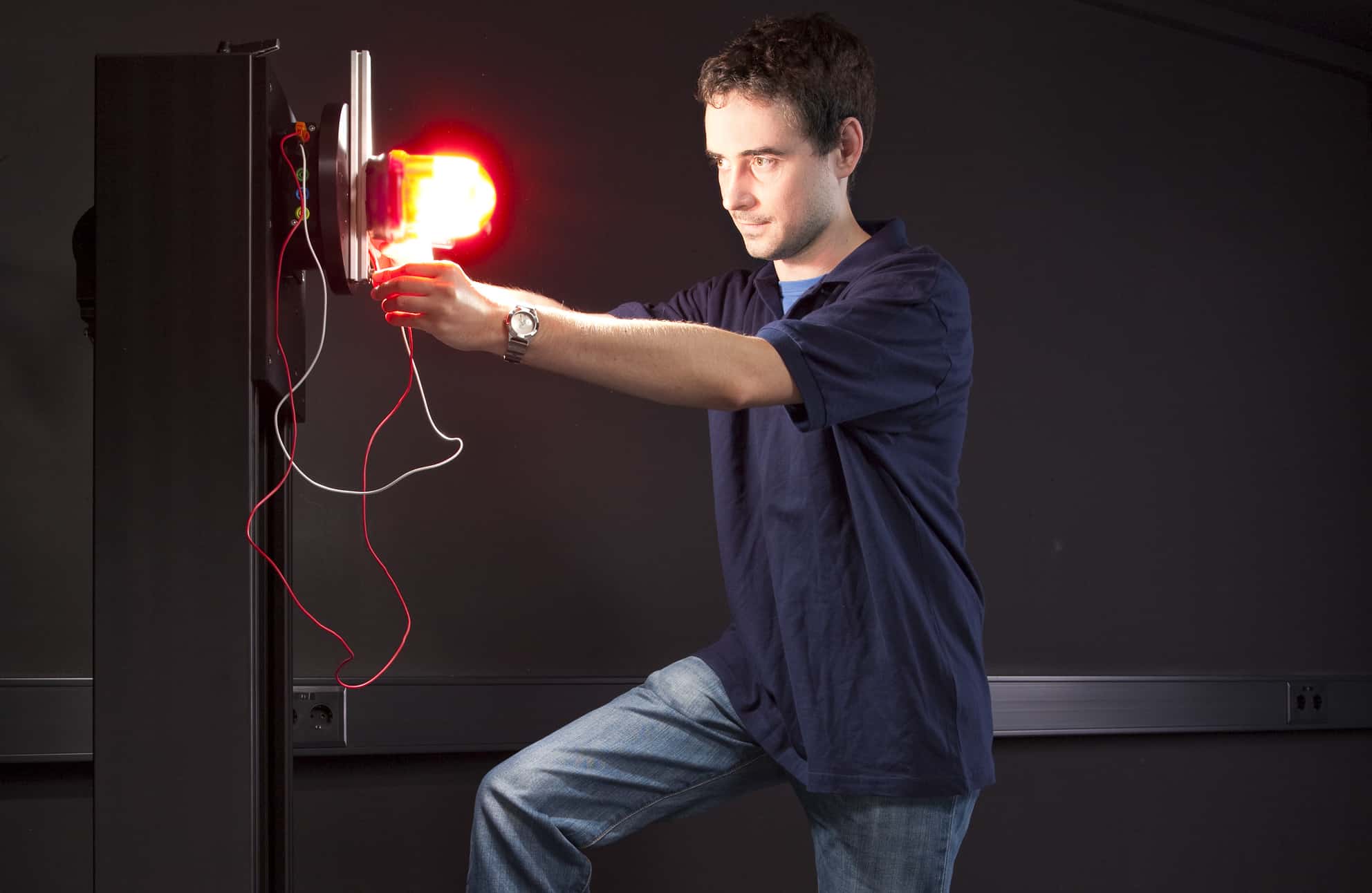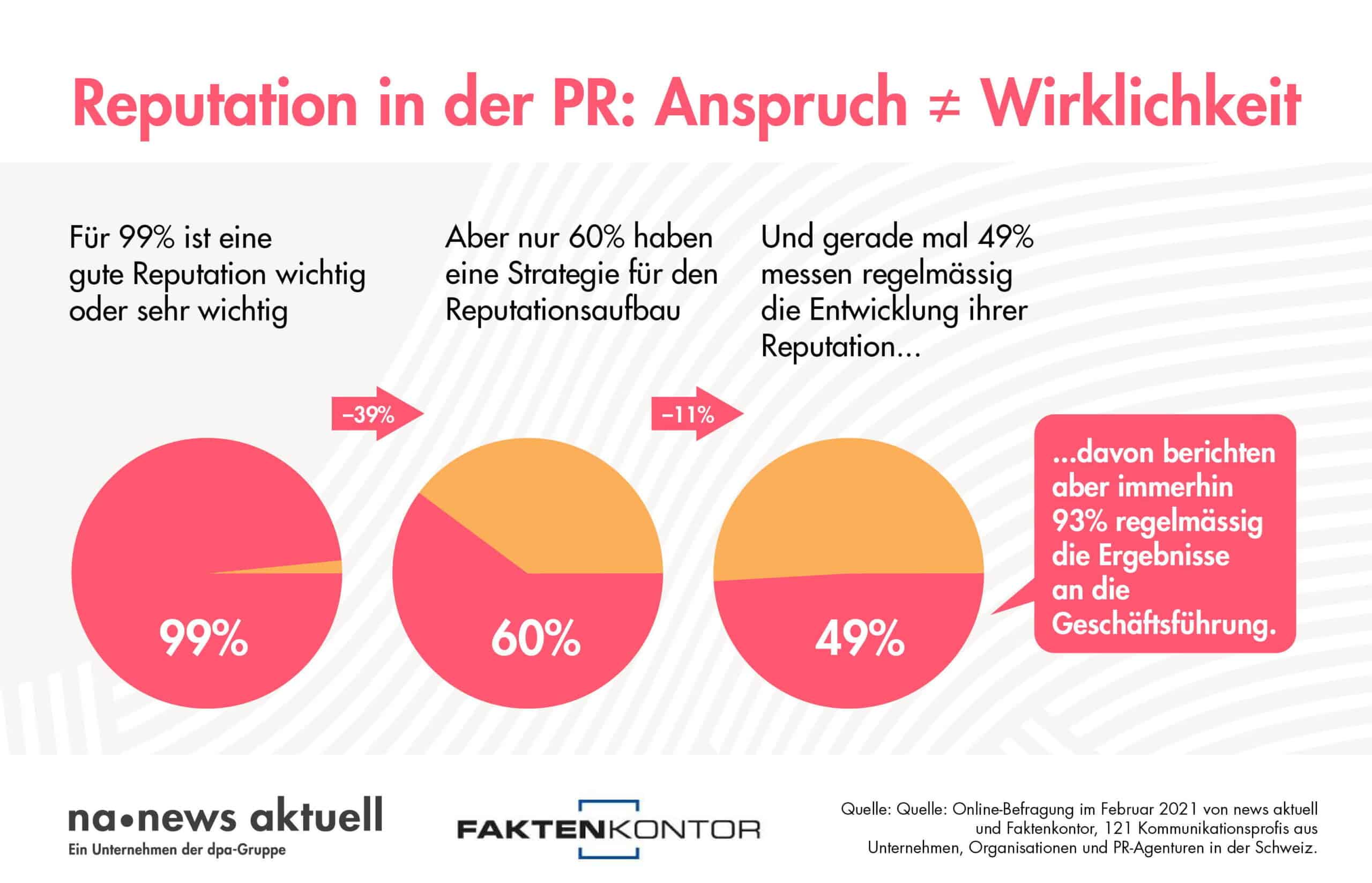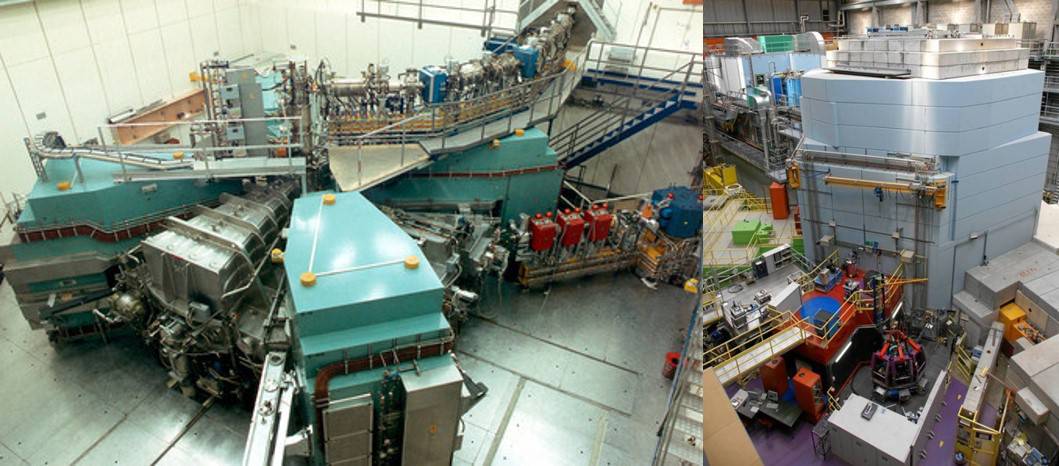Swiss Medtech fordert Änderung der nationalen Medizinprodukteverordnung
Wie geht es der Schweizer Medtech-Branche knapp ein halbes Jahr nach Rückstufung auf Drittstaat? Die Antwort: Für den Export von Medizinprodukten gemäss neuer EU-Regelung ist die Branche den Umständen entsprechend gut aufgestellt. Alarmierend ist die Situation beim Import. Mit den hausgemachten Import-Hürden gefährdet die Schweiz die Gesundheitsversorgung ihrer eigenen Bevölkerung. Swiss Medtech fordert daher dringend eine Änderung der nationalen Medizinprodukteverordnung.

Die diesjährige Konferenz von Swiss Medtech zur Medizinprodukteregulierung vom 19. Oktober stand ganz im Zeichen der neuen Realität Drittstaat, in der sich die Schweizer Medizintechnikindustrie seit Mai dieses Jahres im Verhältnis zur Europäischen Union (EU) – ihrem wichtigsten Handelspartner – befindet. Welche Konsequenzen hat die Blockade mit der EU auf die bisher von Erfolg geprägte Schweizer Medizintechnikindustrie? Welches sind die akuten Probleme und wie könnten sie gelöst werden? An der Konferenz gingen über 500 Branchevertreterinnen und -vertreter dieser Fragen nach.
Export: Die Branche hat sich arrangiert
Gemäss Swiss Medtech hat die Branche das Szenario Drittstaat zu grossen Teilen antizipiert und sich zwei Jahre mit grossem Einsatz darauf vorbereitet, die Zusatzanforderungen für den lückenlosen Export ihrer Ware in die EU zu erfüllen. Dazu gehören im Wesentlichen die Benennung eines Bevollmächtigten im EU-Raum, der stellvertretend Herstelleraufgaben und die solidarische Produktehaftung übernimmt, sowie die Neubeschriftung der Produkte. Heute seien fast alle Unternehmen entsprechend aufgestellt. Die Rechtslage sei klar: Wer MDR¹-Produkte in die EU-exportieren wolle, müsse die Drittstaat-Anforderungen erfüllen. Demgegenüber bestehe in Bezug auf die Medizinprodukte mit bestehenden Zertifikaten (sog. MDD²-Produkte bzw. altrechtliche Produkte) nach wie vor Rechtsunsicherheit. Dürfen sie von der Übergangsfrist bis Ende 2024 profitieren oder nicht? «Die EU sagt Nein, die Schweiz sagt Ja», so der Branchenverband. Jedes Unternehmen müsse in diesem rechtlichen Schwebezustand eine eigene Risikoabwägung machen.
Import: Alarmierende Situation – Patientenversorgung ist gefährdet
Mit Inkraftsetzung der nationalen Medizinprodukteverordnung (MepV) am 26. Mai 2021 hat der Bundesrat hohe Import-Hürden für ausländische Hersteller aufgestellt. Damit schade die Schweiz nicht nur der heimischen Medtech-Industrie, sondern gefährde darüber hinaus die Gesundheitsversorgung ihrer eigenen Bevölkerung. Branchenumfragen würden zeigen, dass jedes achte der heute in der Schweiz verwendeten Medizinprodukte künftig nicht mehr verfügbar sein werde, so Swiss Medtech. Der Grund: Nicht alle ausländischen Hersteller seien bereit, zusätzliche Anforderungen einzig und allein für den kleinen Absatzmarkt Schweiz zu erfüllen. «Zurzeit sind uns Einzelbeispiele von Lieferstopps bekannt. Ab zweite Hälfte nächsten Jahres wird es breit spürbare Versorgungslücken geben», ist Daniel Delfosse, Leiter für Regulierungsfragen von Swiss Medtech, überzeugt.
Bereits im Frühling dieses Jahres hat der Verband zusammen mit anderen Gesundheitsakteuren in einem offenen Brief an den Bundesrat auf die alarmierende Situation aufmerksam gemacht. Ohne Erfolg: Die MepV wurde mit hohen Import-Hürden in Kraft gesetzt.
Dem Verband sei bewusst, dass der Bundesrat die MRA³-Aktualisierung und damit den Schlüssel zum freien gegenseitigen Warenhandel nicht allein in der Hand habe, sondern auch die EU bereit dazu sein müsse. «Umso wichtiger ist es, dass der Bundesrat die Regeln des Imports, die er mittels MepV unabhängig von der EU einseitig festlegen kann, zum Wohle der Schweiz trifft. Das ist heute nicht der Fall», sagt Delfosse. Mit der MepV habe die Schweiz das von der EU übernommene Recht (MDR) noch zusätzlich verschärft (Swiss Finish). «Die Vorlage funktioniert in der Realität nicht. Wir fordern eine dringende Änderung. Mit ein paar wenigen Anpassungen der Verordnung könnte das sich anbahnende Versorgungsproblem massiv entschärft werden. Die Schweizer Regierung hat das allein in der Hand», so Delfosse.
Zukunft: Beziehung mit der EU auf eine solide Basis stellen
Nebst den kurzfristigen negativen Konsequenzen dürfe der langfristige Schaden für den bisher attraktiven Medtech-Standort Schweiz nicht vergessen gehen. «Vielen Entscheidungsträgern scheint nicht bewusst zu sein, wie sehr die Blockade mit der EU der Attraktivität der Schweiz als Wirtschaft- und Forschungsplatz bereits geschadet hat und schaden wird. Der Verband wird sich deshalb weiterhin mit ungebrochenem Engagement mit Partnern und in Allianzen dafür einsetzen, dass die Beziehung der Schweiz mit der EU auf eine solide und dauerhafte Grundlage gestellt wird», sagt Beat Vonlanthen, Präsident von Swiss Medtech.
Quelle: Swiss Medtech
Rückblick auf das europapolitische Medtech-Staccato
Der 26. Mai 2021 war ein Stichtag für die Medtech-Branche: Die neue europäische Medizinprodukteverordnung (¹Medical Device Regulation, MDR) ersetzte die alten EU-Richtlinien (²Medical Device Directive, MDD). Die nationale Medizinprodukteverordnung (MepV) trat in Kraft. Der Bundesrat brach die Verhandlungen mit der EU zum Institutionellen Rahmenabkommen ab, womit eine Chance auf zeitnahe Aktualisierung des Abkommens für den freien bilateralen Handel von Medizinprodukten (³Mutual Recognition Agreement, MRA) abrupt zerrann. Mit der fehlenden Aktualisierung des MRA wurde die Schweizer Medtech-Branche auf Drittstaat zurückgestuft. Die EU-Kommission tat kund, dass Schweizer Zertifikate in der EU ab sofort nicht mehr anerkannt sind, und dass Produkte mit bestehenden, von einer Stelle in der EU ausgestellten Zertifikaten, nicht von der Übergangsfrist bis Mai 2024 profitieren können.