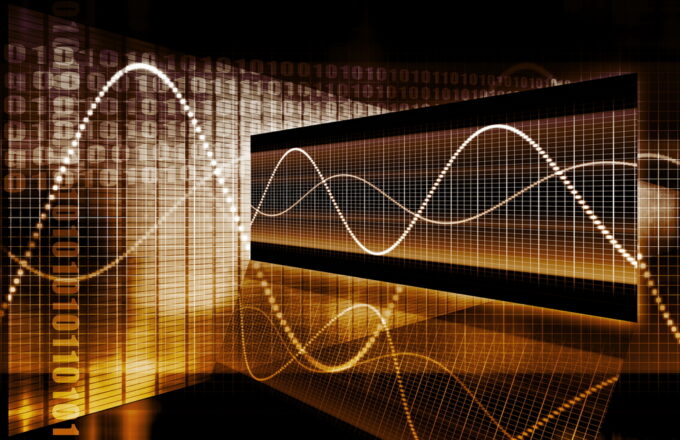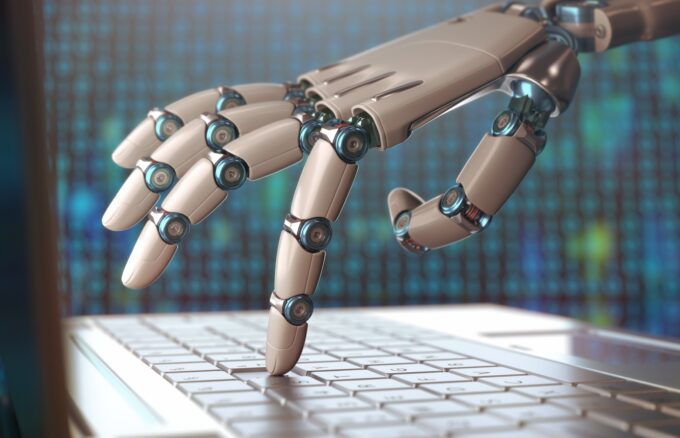
Die eben veröffentlichte Accenture Studie untermauert jene grossen Veränderungen, die sich Unternehmen und die Gesellschaft gegenüber sehen. Demnach sind mehr als vier von fünf Befragten (84 Prozent) der Ansicht, dass Unternehmen dank Technologie heute eine bedeutende Funktion im Alltag der Menschen einnehmen. Verwiesen wird hier unter anderem auf den wachsenden Einfluss KI-basierter Sprachassistenten wie Amazon Alexa, die bereits in vielen Produkten integriert sind und damit auch in immer mehr Situationen des täglichen Lebens an Relevanz gewinnen.
Das stellt Unternehmen jedoch vor neue Herausforderungen im Spannungsfeld zwischen zukünftigen Wachstumschancen und einer grösseren gesellschaftlichen Verantwortung, die sich aus der Allgegenwärtigkeit von Technologie ergibt. Je nahtloser sich Technologie in unseren privaten und beruflichen Alltag einfügt, desto wichtiger wird es für Unternehmen, die Beziehung zu Kunden und Geschäftspartner neu zu definieren und den verantwortungsvollen Umgang mit Technologie in den Mittelpunkt zu stellen.
„Informationstechnologie ist heute fester Teil unseres Lebens und verändert damit auch Arbeit und Gesellschaft”, so Marc Zollinger, Leiter Technology bei Accenture Schweiz. „Je stärker der Einfluss digitaler Innovationen auf unseren Alltag, umso wichtiger wird es, dass die Anbieter entsprechender Services und Technologien Verantwortung übernehmen. Daraus resultiert einerseits, dass Unternehmen um mehr Vertrauen beim Kunden werben und für Transparenz einstehen müssen. Der Kunde hingegen muss sich an das Teilen persönlicher Informationen gewöhnen, will er den maximalen Nutzen aus digitalen Services ziehen.”
Die Technology Vision beschreibt auch, wie sich das Verhältnis zwischen Unternehmen und Verbrauchern von einer Einbahnstrasse zu einer Autobahn wandelt, auf dem in beide Richtungen Daten ausgetauscht werden. Während die Verbraucher bisher vor allem passive Nutzer von Produkten und Dienstleistungen waren, tragen sie mit ihren Daten nun zu deren Funktionieren und kontinuierlichen Weiterentwicklung bei. Diese Entwicklung ermöglicht Unternehmen „integrierte Innovation“, bedarf jedoch eines vertrauensvollen, partnerschaftlichen Verhältnisses zwischen den Akteuren, das weit über den rein funktionellen Wert von Produkten hinausgeht. Gemeinsame Ziele und Werte werden die Beziehung zwischen Unternehmen und dem einzelnen Kunden künftig deutlich stärker prägen. Hierfür braucht es das passende Management in den Unternehmen.
Die fünf Technologietrends für Unternehmen
Um ihrer gesellschaftlichen Verantwortung nachzukommen und neue Partnerschaften im digitalen Ökosystem aufzubauen, sollten Unternehmen insbesondere diese fünf Technologie-Trends beherzigen:
I. KI für alle: die Weiterentwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) für Wirtschaft und Gesellschaft.
Je besser Künstliche Intelligenz funktioniert, desto grösser ist ihr Einfluss auf den Alltag der Menschen. Für Unternehmen, deren Geschäftsmodelle immer stärker auf KI basieren, bedeutet das, ihrer gesellschaftlichen Verantwortung nachzukommen und klare Regeln zu definieren, was KI darf und was nicht.
II. Erweiterte Realität: das Ende von Distanzen
Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR) lassen die Grenze von realer und virtueller Welt immer mehr verschwimmen. Damit verändern diese Technologien die Lebens- und Arbeitsweise der Menschen und nivellieren räumliche Distanzen.
III. Datenkorrektheit: die Bedeutung von Vertrauen
Je stärker sich die Geschäftsmodelle von Unternehmen auf Daten stützen, desto grösser wird eine neue Form der Verwundbarkeit: inkorrekte, manipulierte
und tendenziöse Daten, die zu fehlerhaften Geschäftserkenntnissen und verzerrten
Entscheidungen mit einer erheblichen Auswirkung auf die Gesellschaft führen. Dieser Herausforderung begegnen Unternehmen am besten zweigleisig, indem sie noch stärker auf korrekte Datensets achten und gleichzeitig Anreize zur Manipulation vermindern.
IV. Grenzenloses Geschäft: Partnerschaft im grossen Stil
Unternehmen sind für ihr Wachstum auf technologiebasierte Partnerschaften über Branchengrenzen hinweg angewiesen, aber ihre eigenen veralteten Systeme sind nicht dafür gemacht, solche Ökosysteme von Partnern zu unterstützen. Die führenden Unternehmen von morgen werden die sein, die heute im grossen Stil Partnerschaften anstreben und ermöglichen, ihre internen Systeme und Prozesse aber frühzeitig dafür auslegen.
V. Internet des Denkens: intelligente Umgebungen schaffen
Unternehmen setzen hohe Erwartungen in intelligente Umgebungen, die mittels Robotik, KI und immersiven Erfahrungen entstehen. Um diese intelligenten Umgebungen zum Leben zu erwecken, müssen Unternehmen nicht nur ihre Mitarbeiter weiterbilden und neue Fähigkeiten aufbauen, sondern auch ihre Unternehmens-IT auf den neuesten Stand bringen.
„Mit der rasanten Verbreitung neuer Technologien verändert sich auch die Rolle der Unternehmen: Sie wandeln sich immer mehr vom reinen Anbieter zum Partner in einem umfassenden Innovationsprozess, der gemeinsam mit Kunden, Mitarbeitern, Forschungseinrichtungen und anderen Unternehmen neue Lösungen entwickelt”, so Marc Zollinger weiter. „Dank dieser Vernetzung mit einer Vielzahl von Akteuren und der daraus resultierenden stärkeren gesellschaftlichen Verankerung wächst auch das Vertrauen in die Unternehmen. Damit legen sie den Grundstein für das Wachstum von morgen.”
Über die Technology Vision
Seit fast 18 Jahren beobachtet und analysiert Accenture systematisch die Entwicklung von Unternehmen und Märkten. Das Beratungsunternehmen identifiziert dabei die Technologietrends mit dem grössten disruptiven Potenzial. Dieses Jahr erscheint die Studie unter dem Titel „Eng verbunden mit dem Kunden – Wie ein intelligentes Unternehmen entsteht“. Für die Studie zeichnen die Accenture Labs und Accenture Research verantwortlich. Die aktuelle Ausgabe beruht unter anderem auf der Expertise des Technology Vision External Advisory Board. Dieses Gremium versammelt mehr als zwei Dutzend Entscheider und Unternehmer aus Privatwirtschaft und öffentlicher Hand, Wissenschaft, Wagniskapitalgebern und Start-Ups. Zudem hat das Team der Technology Vision neben Technologie-Vordenkern und Branchenexperten auch fast 100 Führungskräfte von Accenture befragt.