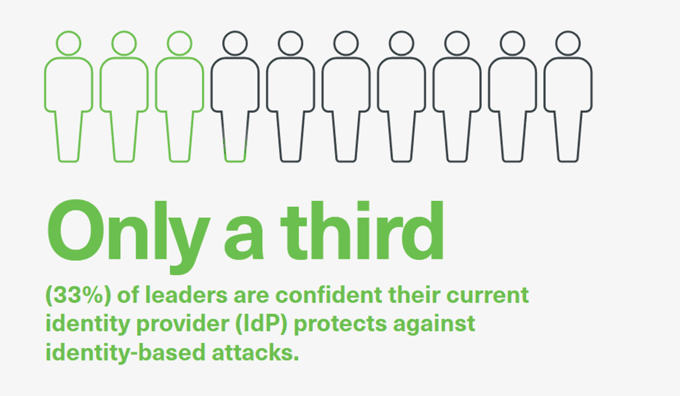Schweizer Unternehmen machen Fortschritte bei der Einführung von KI
Colombus Consulting, in Partnerschaft mit Oracle und der Hochschule für Wirtschaft Genf, veröffentlicht zum zweiten Mal in Folge das Data & KI-Observatorium 2025 für die Schweiz. Die Studie zeigt, dass das Management Schweizer Unternehmen die Herausforderungen im Zusammenhang mit Daten und künstlicher Intelligenz immer besser versteht und dass erste konkrete Anwendungsfälle zunehmen.

Die Untersuchung hat dieselben Ziele wie im Vorjahr verfolgt: Entscheidungsträgern ein Navigationsinstrument an die Hand zu geben, um die Gegenwart zu verstehen, künftige Wendepunkte zu antizipieren und ihre Fortschritte mit denen ihres Sektors oder des Marktes zu vergleichen.
Zentrale Ergebnisse
Die diesjährige Beobachtung zeigt, dass sich das Schweizer Daten- und KI-Ökosystem in einem tiefgreifenden Wandel befindet, mit weniger Pilotprojekten, aber mehr Initiativen, die den Schritt zur Skalierung geschafft haben. 39% (28 Prozentpunkte weniger gegenüber dem Vorjahr) der Organisationen haben die Phase der Erkundung mit identifizierten Anwendungsfällen und Pilotprojekten rund um generative KI hinter sich gelassen. 52% (+8 Prozentpunkte) haben Assistenten oder Module zur Content-Generierung „im grossen Stil“ eingeführt.
Diese Entwicklung geht mit einem besseren strategischen Verständnis einher:
- 62% (+25 Prozentpunkte) geben an, dass ihre Teams über ein gutes bis sehr gutes Wissen zu KI-Konzepten verfügen. Auch die Datenbasen verbessern sich, durch höhere Datenqualität und eine datenorientiertere Entscheidungsfindung:
- 62% (+14 Prozentpunkte) bewerten ihre Datenqualität als gut bis exzellent, und 41% (+3 Prozentpunkte) sehen sich als „data driven“.
Gleichzeitig steigen die Erwartungen und Potenziale rund um KI weiter: 74% der Befragten (+5 Prozentpunkte) sind der Meinung, dass KI die Hauptprobleme des Unternehmens lösen kann.
Dennoch bleiben viele Herausforderungen bestehen und hemmen weiterhin die Industrialisierung. So bewerten 70% (21 Prozentpunkte weniger als im Vorjahr) ihr Ökosystem als von geringer/mittlerer Reife.
Kultureller Wandel als Hürde
Über die Technologie hinaus erfordert die Einführung von KI-Initiativen eine durchdachte Herangehensweise, wie Jean Meneveau, Managing Director von Colombus Consulting Schweiz, betont: „KI verändert die Zeitachsen von Strategien und Projekten mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit […]. Unternehmen haben Mühe, mit diesem Tempo Schritt zu halten. Die Frage nach der Methode ist zentral: Es gilt, sehr operative und pragmatische Initiativen zu starten, aber auch Abstand zu nehmen, die richtigen Technologiepartner zu wählen […] und den Kurs zu halten, auch wenn die Roadmap sich stark ändern kann. Agilität mit grossem A.“
Der kulturelle Wandel bleibt eine der wichtigsten Hürden für die umfassende Integration von KI. 70% der noch wenig engagierten Organisationen geben an, dass das Haupthindernis nicht technischer, sondern menschlicher Natur ist. Ethik wird zudem zu einem unverzichtbaren Grundpfeiler: 70% der Schweizer Organisationen geben an, ethische Überlegungen in ihre Entscheidungsprozesse zur KI einzubeziehen. Die Massnahmen würden aber nur teilweise greifen, so ein weiteres Ergebnis der Untersuchung. Denn nur 53% geben an, zumindest gelegentlich konkrete Massnahmen zur Erkennung und Minderung von Bias zu ergreifen.
Der KI-Einsatz konzentriert sich in Unternehmen auf die Bereiche Kunde und Produkt: 77% (-11 Prozentpunkte) der Anwendungen betreffen kundenorientierte Bereiche (Kundendienst, Marketing, Vertrieb), und 75% (+8 Prozentpunkte) der Anwendungen betreffen produkt- und supply-chain-bezogene Bereiche.
Kontinuierlich lernen
Hinter diesen Erkenntnissen ergeben sich mehrere Lehren, die die wesentlichen Erfolgsbedingungen in Erinnerung rufen: Organisationen, die KI noch nicht nutzen, zeigen auf Führungsebene ein deutlich geringeres Verständnis für KI, was die Weiterbildung von Führungskräften zur unmittelbaren Priorität macht. Yvan Cognasse, Senior Director Enterprise Architects bei Oracle EMEA in Genf, erinnert: „Die eigentliche Herausforderung ist nicht, was KI kann, sondern zu entscheiden, was man mit ihr machen möchte. Dafür braucht es seitens der Entscheidungsträger nicht nur Urteilsvermögen und Neugierde, sondern auch Engagement und den Willen zum kontinuierlichen Lernen. Denn sie sind es, die die Verantwortung haben, die Versprechen der KI in greifbare, nützliche, messbare und langfristig nutzbringende Auswirkungen zu verwandeln.“
Unter den Unternehmen mit schlechter Datenqualität ziehen 80% mindestens einen greifbaren Nutzen aus KI, was beweist, dass unvollkommene Daten Initiativen nicht behindern sollten. Je reifer eine Organisation ist, desto höher ist ihre deklarierte Effizienz – das unterstreicht die Wichtigkeit der Investition in interne Kapazitäten. Die KI-Governance wird gestärkt und bindet nun sowohl die Geschäftsbereiche, Compliance-Abteilungen als auch IT-Teams ein, wobei Ethikkomitees zunehmend die Use Cases vor der Produktivsetzung validieren.
Fazit der Untersuchung: Der anfängliche „Wow-Effekt“ muss in rationale und auf die Geschäftsziele abgestimmte Anwendungsfälle umgewandelt werden. Die Initial-Euphorie sollte so in eine nachhaltige und sichere Einführung überführt werden, die Wert schafft, ohne Modetrends erliegen. Es gibt keine signifikanten Unterschiede zwischen den Branchen in Bezug auf die Fähigkeit von KI, komplexe Probleme zu lösen – was zeigt, dass interne Reife und Kompetenzen die wahren Erfolgsfaktoren sind.
Quelle: Colombus Consulting