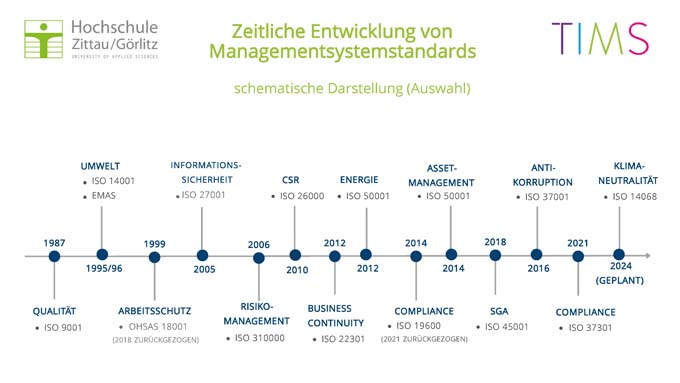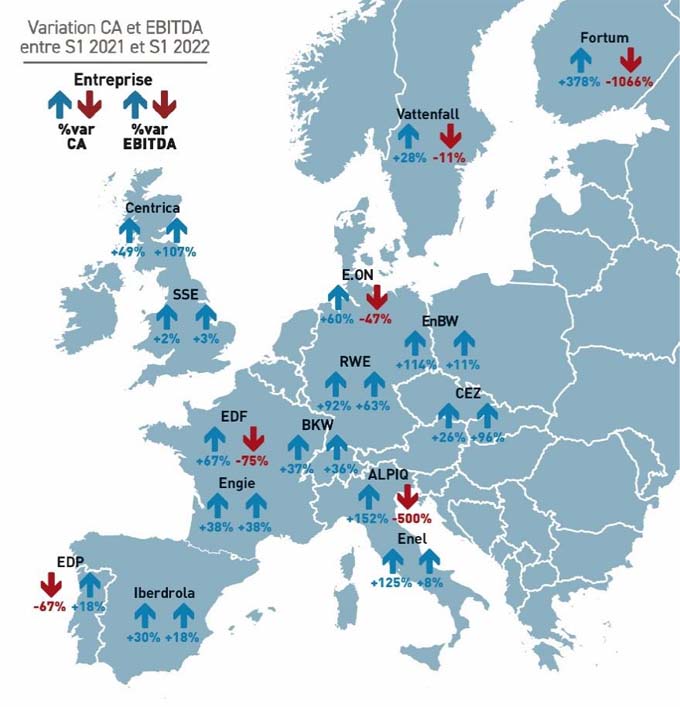Wohin entwickelt sich der Markt mit Produktfälschungen?
Seit mehreren Jahren wächst der Markt für gefälschte Waren rasant. Fälschungen schmälern den immateriellen Wert eines Unternehmens, seinen Umsatz sowie die Wettbewerbsfähigkeit. Konsumierende sehen sich einem steigenden Risiko ausgesetzt – je mehr gefälschte Autoteile, elektrische Komponenten, Medizinprodukte, Mode oder Kopfhörer, desto größer die Schäden für die Gesellschaft.

Der Markenschutz-Softwareanbieter Sentryc GmbH mit Sitz in Berlin führte im Jahr 2022 eine qualitative Umfrage durch, an der unter anderem Firmen der IT-Branche, aus Baugewerbe und Maschinenbau, aus der Automobilindustrie und dem Finanzdienstleistungszweig teilnahmen. Der jährliche Schaden durch Produktfälschungen liegt demnach zumeist zwischen einer Million und 50 Millionen Euro. Mehr als 60 Prozent gab an, es seien bereits Kopien ihrer Produkte im Umlauf gewesen, das Gefahrenpotenzial für Endkunden birgt. Die gute Nachricht: Dank des aktiven Einsatzes von Markenschutz-Software entdeckten Betrogene einen nicht unerheblichen Teil der Plagiate.
Vier Strömungen unter Beobachtung
Im Jahr 2023 fliessen die reale und digitale Welt erwartungsgemäss noch weiter ineinander. Dadurch treffen Konsumierende auf immer mehr Onlineräume. Doch die Weiterentwicklung des virtuellen Einkaufens schlägt auch für Plagiatoren neue Schneisen frei. Dies fordert Markenhersteller, Industrie sowie Beteiligte im Markenrecht heraus. Vier wesentliche Entwicklungen und sich daraus ableitende Handlungsansätze fassen die folgenden, von der Sentryc GmbH erarbeiteten Strömungen zusammen.
- Strömung 1: Creator mit Counterfeits: Fakes im Social Commerce: Durch steigende Popularität von Social Networks wie Facebook, Instagram und Facebook verkaufen Betriebe ihre Produkte zunehmend direkt über diese Kanäle und implementieren dezidierte Social-Commerce-Strategien. Gehypte Produkte fördern eigene Shopping-Dynamiken. Begehrte, über Social Media beworbene Produkte locken Fälscher an. Die Accounts der Produktpiraten – von Software-Algorithmen gesteuerte Social-Bots – benutzen die gleichen Hashtags, wie die Verkäufer:innen der Originale um auf ihre Fake-Produkte und Fake-Shops aufmerksam zu machen. Auch Superapps wie WeChat oder Aliplay bieten Raum für Nachahmer. Neben Messenger-Funktionen decken diese Apps E-Commerce- und Payment-Features ab. Aufgrund ihres nahezu geschlossenen Systems inklusive Zahlungsabwicklung dienen sie als lohnende Plattform für gefälschte Produkte. Raubkopierer nutzen die komplexe und intransparente Struktur dieser App für ihre Zwecke aus. Superapps sind bislang vor allem im asiatischen Raum zu finden, doch der Weg zum deutschen Markt ist bereits vorgezeichnet. Um von politischer Seite aus zu unterstützen, plant die EU mit dem Digital Services Act (DSA) ein neues Gesetz. Die Verordnung verpflichtet Plattform-Anbieter dazu, die Identität von Händlern festzustellen und illegale, gemeldete Produkte zu verbannen. Sie fordert Hersteller dazu auf, selbst gezielte Massnahmen zu ergreifen, die ihre Marken in allen relevanten Ländern schützen. Unter die Arme greift ihnen Brand Protection Software, die soziale Medien überwacht und verdächtige Produkte meldet.
- Strömung 2: Fakes und Brand Abuse im Metaverse: Inzwischen drängen viele Marken ins Web 3.0 und etablieren Auftritte auf unterschiedlichen Plattformen. Das Metaverse bietet Markenherstellern enormes Absatzpotenzial, doch müssen die neuen Gestaltungsräume rechtlich, regulatorisch und gesellschaftlich teilweise erst neu erschlossen werden. In Bezug auf Cyber-Kriminalität und Betrug stehen sie schutzloser und schadenanfälliger als andere digitale Plattformen da. Sicherheitslücken zu schließen, kommt grosse Bedeutung zu. Wie kann die nächste Stufe des Internets nachhaltig gesichert werden? Inhaber geistigen Eigentums sollten sich zwingend rechtlich beraten lassen, ob sie ihre Marken beispielsweise für virtuelle Produkte und Dienstleistungen registrieren lassen. Ebenso empfiehlt sich die Überwachung von Onlineumgebungen auf Verstösse. Weil die Überwachung verschiedener Plattformen erheblichen Aufwand bedeutet, stellen weitsichtige Unternehmen für das Web3 neben einem Marketing- auch ein juristisches Budget bereit.
- Strömung 3: Bewusste Kaufentscheidungen für Fälschungen: Eine aktuelle Studie besagt, dass besonders 26-32-Jährige gefälschte Produkte kaufen würden. (1) Grund: der niedrigere Preis. Durch den Kauf von Plagiaten nehmen Konsument:innen geringere Qualitäten in Kauf. Selbst wenn das Wissen um eine gekaufte Fälschung vorhanden ist, schwingt in der Kaufentscheidung selten das komplette Wissen über das Phänomen Plagiat mit: Von der Lieferkette über die Rohstoffbeschaffung bis hin zum Vertrieb leiden Mensch und Umwelt unter den prekären Bedingungen, Endverbraucher:innen spüren schlussendlich qualitative und gesundheitliche Folgen. Um der Gefährdung von Menschenrechten, Klimaschutz und Gesundheit entgegenzuwirken und eine Änderung herbeizuführen, klärt umfangreiche Information Käufer:innen auf. Rechtlich liegt die Verantwortung beim Fabrikanten und Markeninhaber. Deshalb empfiehlt Nicole Jasmin Hofmann, Geschäftsführerin und Co-Gründerin der Sentryc GmbH, detaillierte Informationen zu den Konsequenzen gefälschter Produkte in ihre Markenkommunikation aufzunehmen. Über Pressearbeit, Beiträgen auf Websites und Partner-Onlineshops verbreiten sich die Informationen.
- Strömung 4: Risikomanagement wird unternehmerisch eine grössere Rolle spielen: Im Risikofeld zwischen Cyber-Vorfällen, Reputationsverlust sowie Betrug spielen Markenrechtsverletzungen eine zunehmend grosse Rolle. Firmen wissen, dass sich Plagiate und Brand Abuse auf den Umsatz auswirken. Damit es zu keinen unternehmerischen Fehleinschätzungen des Risikos kommt, erreicht firmeninterne Transparenz grösseren Stellenwert. Folgende Annahme greift hier: Sobald ein Produkt am Markt gefragt ist, existiert ein wirtschaftliches Interesse, dieses zu kopieren. Daher gilt es schon bei der Produktion die Vielzahl von Möglichkeiten, technischer, mechanischer und prozessualer Natur zu nutzen, um Fälschungen zu erschweren. Verteilung der Fertigungsschritte auf unterschiedliche Produktionsstätten, eindeutige Identifikationsmerkmale wie Wasserzeichen sowie software- und KI-gestützte Überwachung der Handelsplätze und Absatzmärkte stellen einen Teil der Methoden dar. Firmen sollten prüfen, ob sie in puncto Sicherheit und Sorgfaltspflicht alles tun, um Fakes zu unterbinden, und hinterfragen kritisch ihr Risikomanagement und Präventionsmassnahmen. Auch Rechtsabteilungen sollten sich zukünftig verstärkt auf das Thema einstellen.
Fazit: Produktfälschern einen Schritt voraus sein
Um Verlusten durch Produktfälschungen vorzubeugen, müssen Hersteller und Markeninhaber aktiv gegen Plagiate vorgehen. Betriebsinterne Rechtsabteilungen oder erstattete Strafanzeigen helfen zwar im Nachgang, doch bewegt sich die Kopie dann schon auf dem Markt. Wie die Ergebnisse der eingangs erwähnten Studie zeigen, setzt aktuell ein Umdenken in der Überprüfung der Marktsituation sowie in der Durchsetzung der Produkt- und Markenrechte ein. Jetzt heisst es, den Onlinemarkt und neue Kanäle kontinuierlich zu überwachen, um Plagiatoren einen Schritt voraus zu sein.
(1) https://www.ey.com/de_de/forms/download-forms/2022/07/ey-studie-produktpiraterie
Quelle: Sentryc