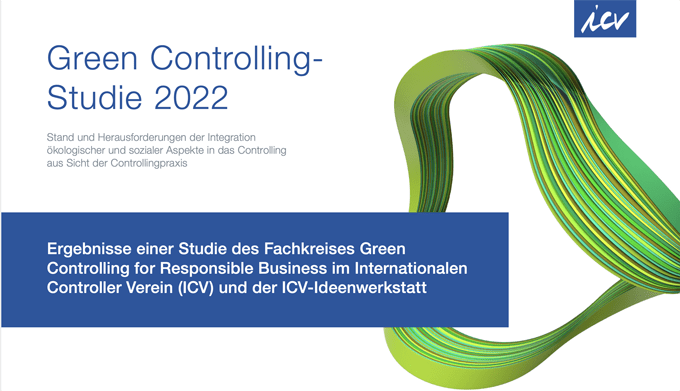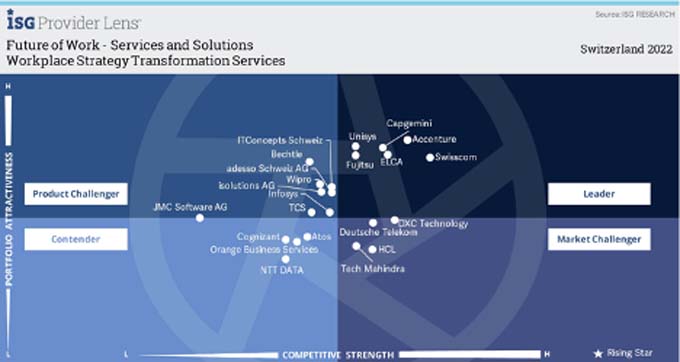Sicherheits-Briefings für neue Mitarbeiter: Mögliche Methoden und Herangehensweisen
Selbst in einem reinen Büroumfeld gibt es so manche Gefahren. Viel grösser sind sie jedoch dort, wo Maschinen und ähnliche Systeme arbeiten – und vielfach hängt ein sicherer Betrieb an menschlichem Wohlverhalten. Doch wie brieft man neue Mitarbeiter diesbezüglich möglichst effektiv? Dafür gibt es mehrere Optionen, alle mit Stärken und Schwächen verbunden.

Betriebsunfälle dürften zweifelsohne zu den grössten möglichen Störungen in Unternehmen gehören – nicht zuletzt deshalb, weil sie in so vielfältiger Form auftreten und schwerste Auswirkungen verursachen können. Prinzipiell reicht die Bandbreite von stolpernden und sich dabei verletzenden Mitarbeitern bis zu zusammenbrechenden Hochlagerregalen, Grossbränden und mitunter sogar massiven Auswirkungen für ganze Landstriche. Denken wir an einen der schwersten schweizerischen Betriebsunfälle, den Grossbrand bei Sandoz anno 1986 – höchstwahrscheinlich ausgelöst durch falsches Verhalten beim Schrumpfen von Plastikfolie bei der Palettierung.
Nun kennt die Schweiz zahlreiche gesetzliche Vorgaben zur Unfallverhütung. Darunter unter anderem die Pflicht zur Einweisung. Zitat aus Art. 6 VUV:
„Der Arbeitgeber sorgt dafür, dass alle in seinem Betrieb
beschäftigten Arbeitnehmer, einschliesslich der dort tätigen
Arbeitnehmer eines anderen Betriebes, ausreichend und
angemessen informiert und angeleitet werden über die
bei ihren Tätigkeiten auftretenden Gefahren sowie über
die Massnahmen der Arbeitssicherheit. Diese Information und
Anleitung haben im Zeitpunkt des Stellenantritts und bei jeder
wesentlichen Änderung der Arbeitsbedingungen zu erfolgen
und sind nötigenfalls zu wiederholen.“
Allerdings lässt sich dieses „angemessen informiert“ auf verschiedene Arten angehen. Welche, das zeigen wir jetzt.
Mitarbeiter sicherheitstechnisch unterweisen
- Filme
Schon im Zweiten Weltkrieg nutzen die USA Filme für die Ausbildung von Soldaten. Einerseits, weil das Lernen dadurch von den didaktischen Fähigkeiten der Ausbilder entkoppelt wurde. Andererseits, weil Filme bestimmte Sachverhalte zielgruppensprachlich „auf den Punkt“ bringen können. Bis heute sind Lehrfilme deshalb auch im Bereich Arbeitssicherheit ein weltweit gängiges Lehrmittel, das jedoch mit verschiedenen negativen Tatsachen verknüpft ist:
- Dauerhafte Aufmerksamkeit nötig.
- Häufig nur allgemein gehalten, nicht auf den konkreten Arbeitsort bezogen.
- Mitunter irrelevante/veraltete Informationen.
- Unterhaltungs- kann Informationswert übersteigen.
- Kaum Möglichkeit zum Wiederholen des Wissens.
- Aufwendig und teuer zu produzieren.
- Präsentationen
Die Präsentation ähnelt der filmischen Herangehensweise. Allerdings ist sie insofern besser geeignet, als dass hier eine multimediale Informationsvermittlung durch Folien, Fotos und Clips um zusätzliche Erläuterungen anwesender Personen ergänzt wird. Das ermöglicht ein deutlich besseres Eingehen auf die Zuhörerschaft, zudem kann eine Präsentation mit geringem Aufwand an wechselnde Anforderungen angepasst werden. Die Nachteile:
- Gute Präsentationen hängen maximal von den Fähigkeiten des Präsentierenden ab – sowohl während der Unterweisung als auch beim Ausgestalten der Folien.
- Jede Präsentation ist etwas anders, selbst wenn dieselbe Person sie mit denselben Folien hält.
- Aufzeichnung und somit Wissenswiederholung nur über Umwege (Videos) möglich.
- Handouts und Kataloge
Nicht umsonst werden bis heute die meisten Betriebsanleitungen in ausgedruckter Form beigelegt. Denn das geschriebene Wort ist äusserst geduldig, günstig in der Umsetzung und vor allem kann jeder ohne eigenes Zutun (etwa Mitschreiben) die vermittelten Informationen immer wieder und wieder durchgehen – ohne Notwendigkeit einer begleitenden Person. Überdies können solche Handouts auf leichte Weise zu einem Gateway in die digitale Welt gemacht werden. Dann, wenn sie mit einem wirklich leistungsfähigen Werkzeug kombiniert werden, dem QR-Code. Er kann beispielsweise an passender Stelle zu die schriftlichen Informationen ergänzenden Clips führen, kann abschliessende Tests einleiten oder verschiedenste andere digitale Brücken schlagen. Da der QR-Code im Prinzip nur eine URL benötigt, kann sich dahinter alles nur Denkbare verbergen.
Doch machen diese Tatsachen Handouts zur besten Herangehensweise für Sicherheits-Briefings? Nicht zwingend:
- Leser müssen der Sprache mächtig sein
- Lesen und Verstehen sind zwei getrennte Anforderungen – je schlechter das Geschriebene, desto schwieriger das Verstehen.
- Keine Möglichkeit, ein intensives Durchlesen und Verstehen durch alle Mitarbeiter zu verifizieren – zumindest nicht ohne Test.
- Kann aufgrund seiner Natur auf manche Charaktere zu trocken wirken, was die Aufmerksamkeit deutlich reduziert.
- Comics
Comics schaffen es, mit wenigen gezeichneten Bildern, und teils sogar völlig ohne weiteren Text, komplexe Geschichten zu erzählen – nicht nur für Kinder. Erneut waren es Militärs, die deshalb schon frühzeitig eine solche Herangehensweise wählten, um Soldaten konkrete Sachverhalte nahezubringen. Der Vorteil besteht in der Möglichkeit, sehr spezifische, komplexe Informationen zu vermitteln, da Comics nicht nur auf Text setzen, sondern eine Bebilderung. Ferner können selbst Comics zu eher trockenen Themen durch eine spannende Gestaltung Aufmerksamkeit erhalten – und mitunter sogar sprachübergreifend sein. Die Nachteile klassischer schriftlicher Handouts werden deshalb stark vermindert. Allerdings sind Comics ebenfalls nicht perfekt:
- Erstellung erfordert grafische Expertise. Schreiben kann beinahe jeder, zeichnen jedoch nicht.
- Kann mitunter auf manche Zeitgenossen zu infantil wirken.
- Aufgrund des Umfangs eher nur für spezifische Themen geeignet, etwa „Sicherheitsüberprüfung am Gabelstapler vor Arbeitsbeginn“.
- Online-Kurse
Eine Website kann im Prinzip alles darstellen, was im Rahmen der genutzten Programmiersprache und des zur Verfügung stehenden Speicherplatzes gewünscht wird. Dadurch kann sie natürlich auch ein Mittel sein, durch das sich eine enorme Bandbreite an Sicherheitsinformationen für neue Mitarbeiter übermitteln lässt.
Schriftlich, bildlich, sprachlich, das alles kann hier angewendet werden und lässt sich zudem durch die Probanden selbst nach Gutdünken wiederholen. Tatsächlich kann das gesamte Briefing sogar auf eine Weise gestaltet werden, die es möglich macht, die Verwendung zu messen – etwa über eine Verweildauer auf der jeweiligen Folie oder die Notwendigkeit zum Anklicken mehrerer Informationen, bevor die nächste Seite aufgerufen werden kann.
Dem gegenüber steht zwar nur ein Nachteil, dieser ist jedoch recht gross. Denn um solche Kurse aufzubauen, ist viel fachliche und IT-Expertise vonnöten. Je hochwertiger alles sein soll, desto kostspieliger und aufwendiger wird es.

Sicherheits-Briefings: Die Mischung machts
Sie haben es vielleicht schon bemerkt: Keine der hier vorgestellten Methoden ist für sich allein perfekt – und sei es nur deshalb, weil sie kostspielig ist. Zwar sollte kein Unternehmen an etwas so zentral Wichtiges wie Sicherheitsunterweisungen ein Preisschild hängen, dennoch muss natürlich ein gewisser Rahmen gewahrt bleiben.
Doch was ist unter dieser Prämisse die beste Herangehensweise? Es ist stets eine ausgewogene Mischung aus mehreren Methoden. Die vielleicht beste Basis ist eine saubere Präsentation, ganz besonders dann, wenn mehrere neue Teammitglieder gleichzeitig unterwiesen werden sollen. Darin lässt sich alles sehr gut verpacken.
Ergänzend dazu wird ein Handout ausgegeben. Einerseits sollte es dieselben Inhalte wie die Präsentationsfolien beinhalten. Andererseits kann es um weitere schriftliche und Comic-artige Informationen ergänzt werden. Wo es sinnvoll ist (etwa bei Videos) sollte zudem stets ein QR-Code integriert werden, der auf die entsprechenden digitalen Inhalte überleitet – gerade für jüngere Generationen von Digital Natives ist das dringend angeraten.
Bei dieser Vorgehensweise werden Sicherheits-Briefings zu mehr als nur einer einmaligen Unterweisung. Es wird zu einem multimedial wirkenden, immer wieder nachschlagbaren und ergänzbaren Kodex der Sicherheit. Wird dies noch geschickt mit Realitäten der Arbeitsumgebung kombiniert (beispielsweise durch gleichlautende Bezeichnungen am Arbeitsort), dann wird daraus eine Informationsvermittlung, die sich wirklich im Kopf festsetzt – und so hilft, grosse und kleine Betriebsunfälle zu vermeiden.