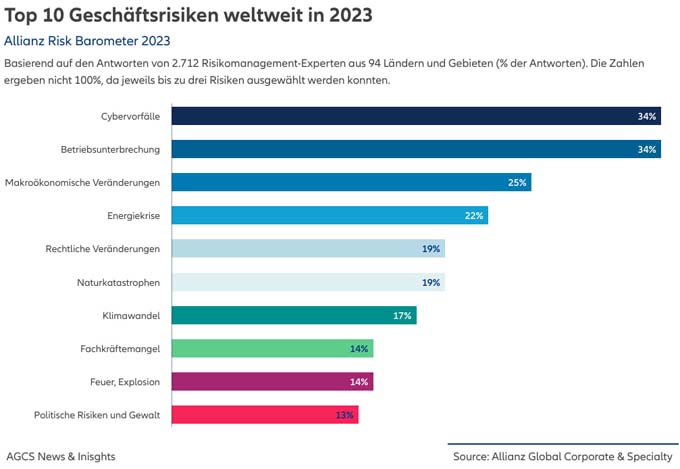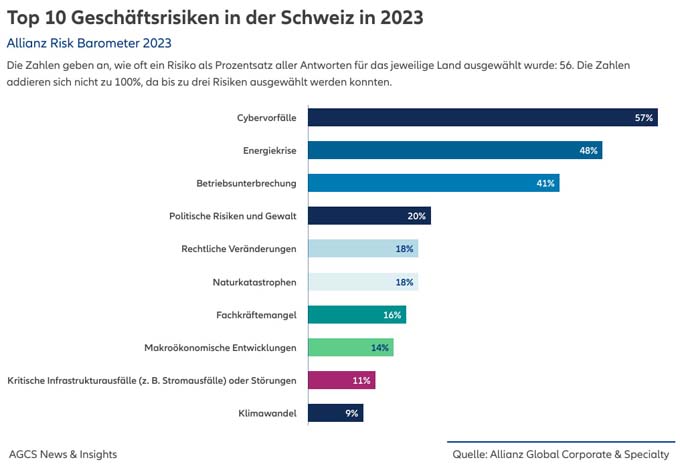Keine Atempause für Apotheken
Nach zwei Jahren, die durch die Höhen und Tiefen der Covid-19-Pandemie geprägt waren, sind Apothekerinnen und Apotheker nun mit den sich verschärfenden Medikamentenengpässen konfrontiert. Diese betreffen derzeit auch günstige Standardmedikamente. Eine Bilanz und Ausblicke.

2022 war ein Jahr des Übergangs zu einer gewissen Normalität nach zwei Jahren, die durch das Coronavirus geprägt waren. Die Apothekerinnen und Apotheker sowie ihre Teams haben enorme Arbeit geleistet, um die Bedürfnisse der Bevölkerung professionell und kompetent zu erfüllen. Wie in anderen Bereichen des Gesundheitswesens nimmt das Arbeitsvolumen in Apotheken zu, und bei den Teams macht sich Ermüdung sowie ein Mangel an Fachkräften bemerkbar.
Nach der Pandemie – die Zeit der Knappheit
Seit mehreren Monaten sind die Apothekenteams mit Schwierigkeiten konfrontiert, die auf Versorgungsengpässe bei den Medikamenten zurückzuführen sind. Diese Woche sind laut www.drugshortage.ch 781 Medikamente (insgesamt nahezu 1000 verschiedene Packungen!) in der Schweiz nicht erhältlich. Es betrifft mehr als 361 Wirkstoffe. In Spital- und Offizinapotheken sorgen Lieferunterbrechungen für enorme logistische und sicherheitstechnische Probleme und binden erhebliche personelle Ressourcen. Die für eine öffentliche Apotheke auf ½ bis 1 Tag pro Woche geschätzten Kosten werden nicht übernommen. Dank der Fachkenntnisse der Apothekerinnen und Apotheker können grössere Probleme glücklicherweise vermieden werden, wenn die Behandlung geändert werden muss. In manchen Fällen können sie sogar Medikamente selbst herstellen, um Fehlbestände abzudecken.
Diese Situation, auf die pharmaSuisse, die Dachorganisation der Apothekerinnen und Apotheker, seit mehreren Jahren hinweist, verschlechtert sich zusehends. Die Behörden würden die Problematik nur zögerlich aufgreifen, schreibt der Verband. Deshalb wird pharmaSuisse in diesem Frühjahr im Rahmen einer breiten Allianz von Fachleuten und Partnern des Gesundheitswesens an der Lancierung der Volksinitiative «Ja zur medizinischen Versorgungssicherheit» mitwirken.
Apothekerinnen und Apotheker – Akteure des Gesundheitswesens, deren volles Potenzial nicht genutzt wird
Apothekerinnen und Apotheker sowie ihre Teams könnten im Gesundheitswesen noch viel wertvollere Dienste leisten. Das bedingt allerdings, dass die Behörden sie dauerhaft ins System einbinden und nicht nur bei einer grossen Gesundheitskrise zu Hilfe rufen.
Der Bundesrat hat in seinem zweiten Massnahmenpaket zur Kostendämpfung in der OKP (Obligatorische Krankenpflegeversicherung) das Potenzial der Apotheken erkannt, weshalb er die Änderung von Artikel 25 und einen neuen Absatz in Artikel 26 KVG vorschlägt. Damit wird (endlich) die Möglichkeit geschaffen, Leistungen zu erbringen, die von der Grundversicherung übernommen werden, beispielsweise im Bereich der Prävention (z. B. Impfungen) und pharmazeutische Leistungen, wie die Unterstützung bei der Therapietreue oder die Analyse komplizierter Medikationen. Die genannten Leistungen müssen wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich sein (WZW-Kriterien) und nachweislich eine kostendämpfende Wirkung haben. In der nationalrätlichen Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit haben die Diskussionen über dieses zweite Paket bereits begonnen.
Mit der Änderung des Medizinalberufegesetzes (MedBG) im Jahr 2015 und des Heilmittelgesetzes (HMG) im Jahr 2016 hat der Gesetzgeber dazu beigetragen, die Rolle der Apotheken innerhalb der medizinischen Grundversorgung zu festigen. «Dennoch ist sich die Bevölkerung noch nicht ausreichend bewusst, dass sie auch in den Apotheken medizinische Beratung in Anspruch nehmen kann. Apothekerinnen und Apotheker verfügen über das entsprechende Grundwissen zur Diagnose und Behandlung von häufig vorkommenden gesundheitlichen Problemen und Krankheiten. In der heutigen Situation der überlasteten Notaufnahmen sind sie in der Lage, die Triage der Patientinnen und Patienten zu übernehmen, ihnen eine Lösung anzubieten und so die Notaufnahmen und Hausarztpraxen bei einfachen Fällen zu entlasten. Das steht ausser Frage! » meint Martine Ruggli, Präsidentin von pharmaSuisse.
Die Revision des Vertriebsanteils findet einen breiten Konsens
In einem angespannten Wirtschaftsklima mit Gesundheitskosten, die vor allem aus gesellschaftlichen Gründen immer weiter steigen, sind Medikamente regelmässig das Ziel Nummer eins. Dabei rücken vor allem der Preis und die Verbreitung von Generika sowie der Vertriebsanteil in den Fokus. Ende 2022 wurde unter der Ägide des Eidgenössischen Departements des Innern (EDI) und des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) ein Konsens zur Revision des Vertriebsanteils (Art. 38 KLV) zwischen den Leistungserbringern (FMH, APA Vereinigung der Ärzte mit Patientenapotheke, H+ Die Spitäler der Schweiz, GSASA Schweizerischer Verein der Amts- und Spitalapotheker, Schweizerischer Apothekerverband pharmaSuisse) und curafutura gefunden, leider ohne die Unterstützung von santésuisse. Dieser Konsens wird die negativen Anreize korrigieren und den Einsatz von Generika steigern. Sein sofortiges Einsparungspotenzial wird auf 60 Millionen Franken und anschliessend, durch einen höheren Anteil an Generika, auf potenziell 100 Millionen, geschätzt. Der Ball liegt nun beim EDI.
Ausblick 2023
Die Apothekerinnen und Apotheker unterstützen die Bemühungen des Bundesrates, die Zunahme der Gesundheitskosten zu bremsen, so pharmaSuisse in ihrer Stellungnahme an die Medien. Diese Einsparungen würden nicht durch einen Angriff auf die Margen von preiswerten Medikamenten erfolgen, sondern der Weg bestehe eindeutig darin, die Dienstleistungen der Apotheken für die Patientinnen und Patienten weiter auszubauen. In diesem Sinne hofft pharmaSuisse, dass 2023 mit der Lockerung des KVG-Korsetts (Art. 25 und 26 des zweiten Massnahmenpakets) und der Revision des Vertriebsanteils ein Schlüsseljahr für die Apotheken sein wird.
Im Bereich der Digitalisierung des Gesundheitssystems soll 2023 gemeinsam mit der FMH eine nationale Lösung für ein gesetzeskonformes, sicheres und in allen Apotheken verwendbares elektronisches Rezept eingeführt werden. Die angestrebte Lösung wird für Patienten, Ärzte und Apotheker benutzerfreundlich sein. Auf dem Fahrplan der Dachorganisation der Apotheker stehen einige Projekte, um die Kenntnis und die Wahrnehmung der Apothekenleistungen in der Bevölkerung zu verbessern. Dies mit dem Ziel, die derzeitige Belastung des Grundversorgungssystems unter den Leistungserbringern besser zu verteilen, die interprofessionellen Zusammenarbeit fortzusetzen sowie die Berufe in der Apotheke zu fördern und den Nachwuchs zu sicher und der Bevölkerung qualitativ hochwertige Leistungen anzubieten.
Quelle: pharmaSuisse