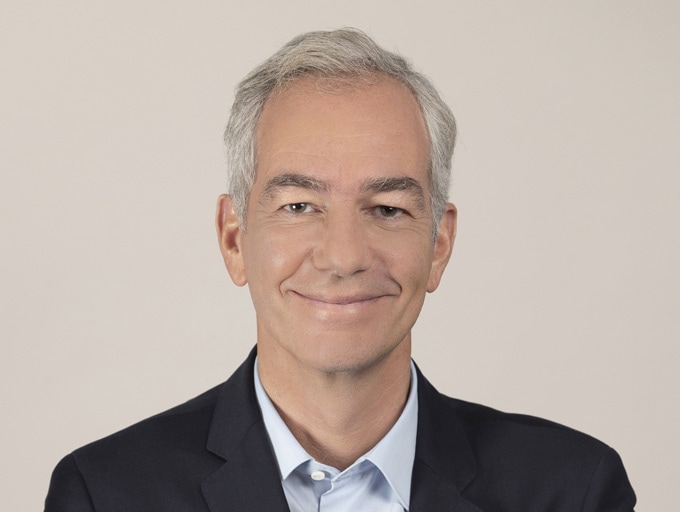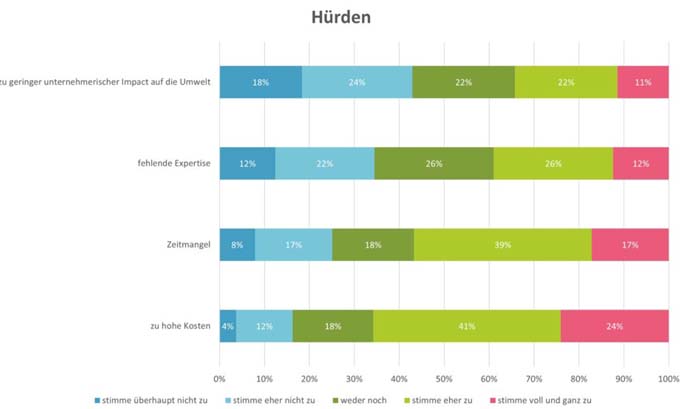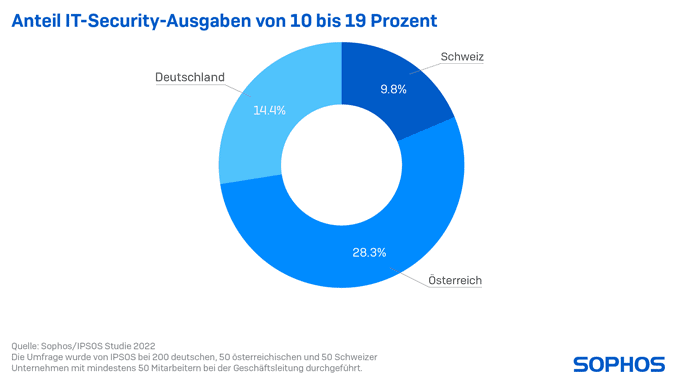Studie warnt: Fachkräftemangel wird sich weiter verschärfen
Die Lage auf dem Arbeitsmarkt wird gemäss einer internationalen Studie immer prekärer. Durch ein internes Skill-Management könnten Unternehmen allerdings drastisch bei HR-Aufwänden sparen.

Es mangelt an qualifizierten Fachkräften. Das bestätigen auch 73 Prozent von 250 befragten Unternehmen unterschiedlichster Branchen in der DACH-Region: Der Mangel wird sich weiter verschärfen, so die Zahlen des „Industriereport Fachkräftemangel 2022“, die Skilltree, ein europäischer Hersteller von HR-Software, erhoben hat. 72 Prozent der Firmen schaffen deswegen nur eine begrenzte Zahl an Projekten – und müssen alles darüber hinaus ablehnen. „Viele Arbeitgeber haben sich dazu verleiten lassen, über die Jagd nach externen Fachkräften die internen Mitarbeiterressourcen zu übersehen. Statt die einzelnen Skills zu kennen und auch gezielt für Inhouse-Fortbildungen zu nutzen, konzentrieren sich die HR-Abteilungen nur nach aussen“, erklärt Studien-Herausgeber Markus Skergeth und Geschäftsführer von Skilltree. Sein Unternehmen setzt an diesem Problem an und hilft Arbeitgebern und Arbeitnehmern, Skills kennenzulernen und mit Aufgaben und Projekten zu matchen. So lässt sich der Fachkräftemangel schnell lindern – denn bis zu 30 Prozent der fehlenden Skills sind bereits im Unternehmen vorhanden, ohne das es bei den Entscheidern bekannt ist.
Frühere Jobs: Unbekannt
So kennen bei den aktuellen Arbeitgebern nur 18 Prozent den kompletten Karriere-Background ihrer Mitarbeitenden – knapp 50 Prozent hingegen nicht oder nicht bei jedem Mitarbeiter. „Während in der Bewerbungsphase die Berufserfahrung noch wichtig ist, beginnt sie ab dem Start zu verschwimmen – neue Mitarbeitende werden im Onboarding eher ‚eingenordet‘, anstatt die in vorigen Jobs gelernten Skills sinnvoll zu nutzen“, analysiert Markus Skergeth weiter. Eine durch Software gestützte Skill-Analyse erlaubt hingegen ein optimales Management der Ressourcen – und erschließt oft Potential bei Mitarbeitenden, das den Teamleitern und Führungskräften bisher verborgen blieb. „Unsere Lösung schliesst eine wesentliche Lücke, die wir in zahlreichen Projekten in Unternehmen gesehen haben. Human Resources existieren nicht nur auf dem Arbeitsmarkt – sondern vor allem im eigenen Unternehmen“, erläutert der Skilltree-Chef. Dabei nutzen über 50 Prozent der 250 befragten Studienteilnehmer keine Datenbank, um Mitarbeiterkenntnisse zu erfassen – 30 Prozent zumindest sporadisch, weniger als zehn Prozent nutzen eine vollumfängliche Lösung zum Skill Management.
Besondere Talente bleiben ungenutzt
Noch drastischer fällt die Ignoranz mancher Arbeitgeber bei besonderen Kenntnissen und Fertigkeiten wie bspw. Fremdsprachen auf: Weniger als 20 Prozent der Unternehmen motivieren ihre Mitarbeitenden dazu, solche Leistungen und Talente einzubringen – 45 Prozent hingegen kaum bis überhaupt nicht. „Unser Skill-Matching motiviert Mitarbeitende und sorgt für mehr Zufriedenheit durch mehr Sichtbarkeit. Damit löst sich ein Teil des Fachkräftemangels bereits auf“, ergänzt Markus Skergeth. Dem Bedarf an einer Lösung zum Skill Management stimmen die 250 befragten Unternehmensvertreter aus den Führungsetagen daher nachdrücklich zu: 69 Prozent sehen im Aufbau einer Fähigkeits- und Kompetenzdatenbank eine Chance, den Mangel an Fachkräften durch interne Kräfte mildern zu können. Damit verbunden sind laut „Industriereport Fachkräftemangel 2022“ drastische Einsparungen bei der Personalbeschaffung: 30 Prozent der Befragten hält Einsparungen bis zu 25 Prozent für möglich, weitere 27 Prozent sogar zwischen 25 und 50 Prozent.
Quelle: Skilltree