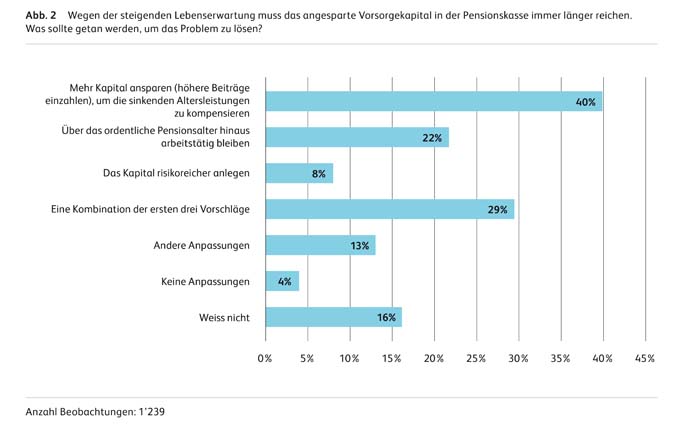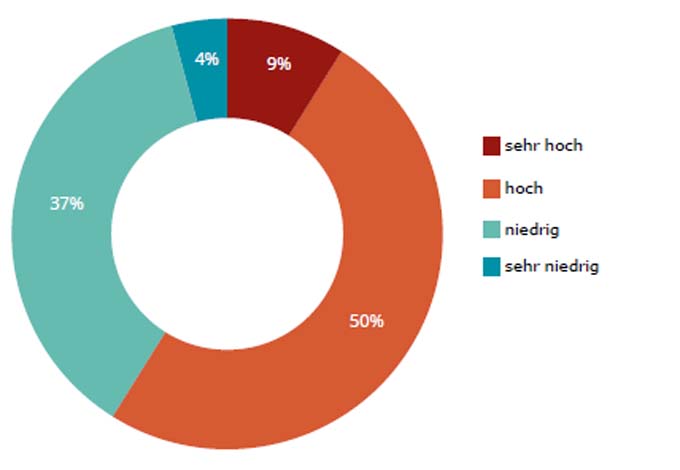ConSense: Software für QM- und Integrierte Managementsysteme mit neuen Features
Die neue Version ConSense 2022.1 ist da: Der Aachener Softwareentwickler ConSense GmbH gibt einen Einblick in die Neuerungen der Software für QM- und Integrierte Managementsysteme.
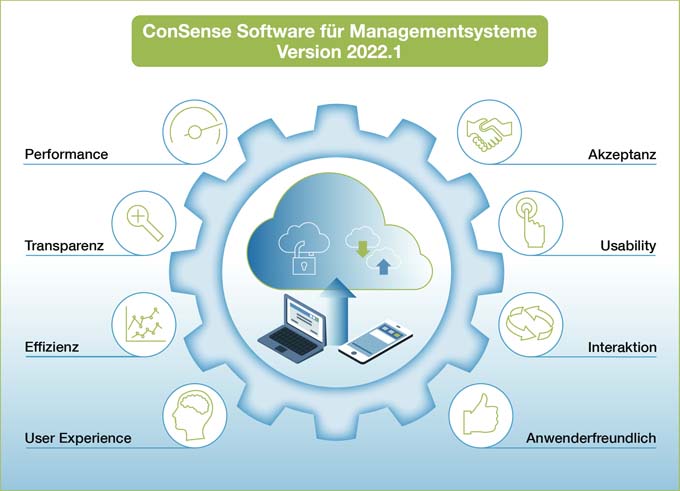
Die Standardsoftwarelösungen von ConSense sind für die spezifischen Anforderungen von Unternehmen jeder Grössenordnung aus allen Branchen geeignet. Sie sind laut Hersteller besonders anwendungsfreundlich, modular aufgebaut und skalierbar. Die Bandbreite reicht von QM-Software für QM-Systeme nach DIN EN ISO 9001 über Software für Integrierte Managementsysteme zur Abbildung zahlreicher weiterer Normen bis hin zu hochspezialisierter Managementsoftware für GxP-relevante Systeme.
Zeitgemässe Managementsoftware: Genderneutrale Anrede, Datenschutz und mehr
Mit vielen Neuerungen passt sich die ConSense Managementsoftware modernen Anforderungen an. So unterstützt sie nun unter anderem auch eine genderneutrale Anrede und nutzt genderneutrale Icons. Ausserdem lassen sich für die zuverlässige Erfüllung von Datenschutzvorgaben Elemente aus Workflows automatisch dauerhaft löschen oder anonymisieren, wenn Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind. Das System stellt dazu transparente Übersichten bereit. Damit im herausfordernden Arbeitsalltag keine Fristen oder Termine versäumt werden, können nun sämtlichen Workflowschritten Erinnerungen hinzugefügt werden, z. B. an die Bearbeitung von Aufgaben. Diese werden automatisch vor der Fälligkeit an den definierten Personenkreis versendet. Vorgesetzte Personen behalten mit der neuen Version die Umsetzung von Aufgaben durch die ihnen zugeordneten Beschäftigten noch besser im Blick: Durch zusätzliche Rechte können sie nun Einsicht in die Massnahmen-Workflows ihrer Beschäftigten erhalten und mit weiteren Berichten, z. B. über die Kenntnisnahmen von verteilten Informationen, immer im Bild bleiben. Im Bereich der Dokumentation ist nun zudem das Duplizieren von Prozessen, Dokumenten und Verzeichnissen sowie das Wiederherstellen von Revisionen möglich. Bei der Erstellung oder Bearbeitung von Inhalten kann so noch mehr Zeitersparnis erreicht werden.
Mehr Flexibilität im ConSense PORTAL
Das ConSense PORTAL ist die webbasierte ConSense Lösung für endgeräteunabhängige Managementsysteme. Es vereinfacht den Roll-out, ermöglicht eine mobile Nutzung und kann von den ConSense Hosting Services unterstützt werden. Die Version 2022.1 bietet jetzt weitere neue Nutzungsmöglichkeiten und das Softwarehaus hat zudem viele Details verfeinert. So lässt sich nun beispielsweise global detailliert festlegen, welche Informationen in den Prozesseigenschaften angezeigt werden sollen. Für einen transparenten Vergleich von Versionen stellt die Historie jetzt für einzelne Revisionen ein Elementmenü zur Verfügung, mit dem sich Anwender:innen direkt die Unterschiede anzeigen lassen können. Wie immer standen auch bei dieser Version die Anwender:innen im Fokus der Entwicklungsarbeit des Aachener Softwareentwicklers: Die Usability und die User Experience wurden ganz im Sinne der Philosophie des Unternehmens – akzeptierte und gelebte Managementsysteme zu schaffen – noch weiter optimiert.
Digitales, webbasiertes Schulungsmanagement und Qualifikationsmanagement
Ausserdem ist mit dem neuen Release das Modul ConSense Qualifikationsmanagement, mit dem Unternehmen die Qualifikationen, Kompetenzen und Ressourcen der Beschäftigten effizient und transparent managen, nun auch webbasiert verfügbar. Dies gilt ebenso für das Modul ConSense Schulungsmanagement, das Unternehmen von der Planung über die Beantragung und Genehmigung von Schulungsteilnahmen, die Durchführung, Dokumentation und Wirksamkeitsbewertung bis hin zum automatischen Zertifikatsausdruck unterstützt.
www.consense-gmbh.de
Für Interessierte findet zwischen 20. und 23. September 2022 eine virtuelle Messe statt mit vielen Hintergrundinformationen rund um Qualitäts- und andere Managementsysteme.