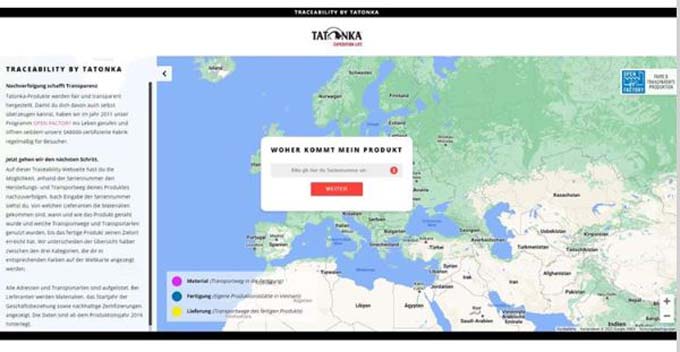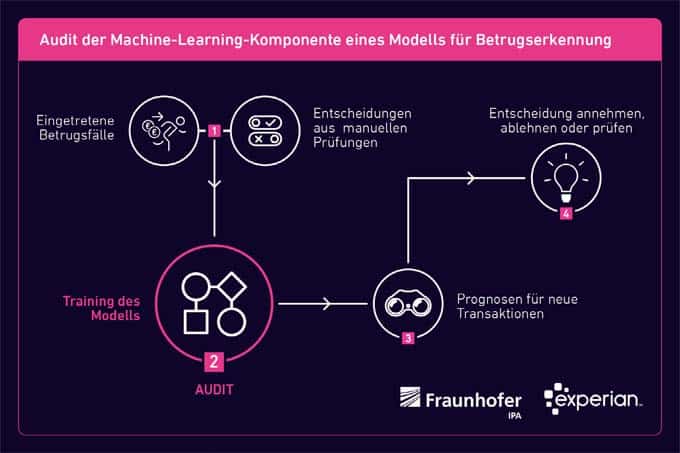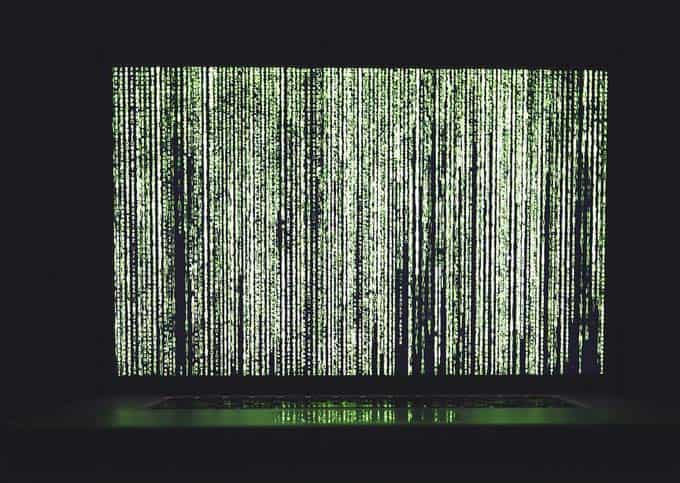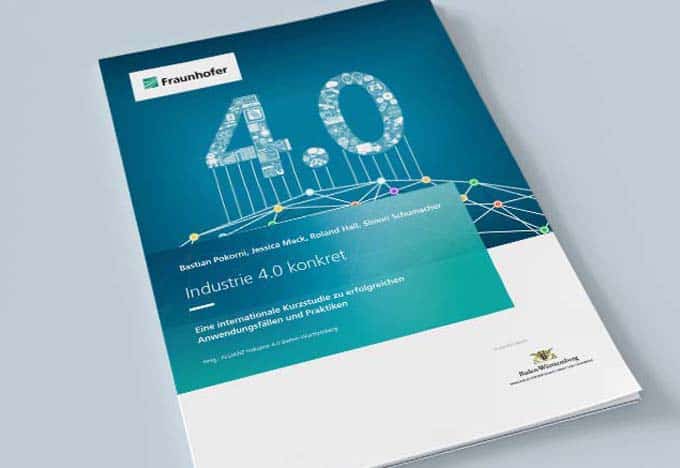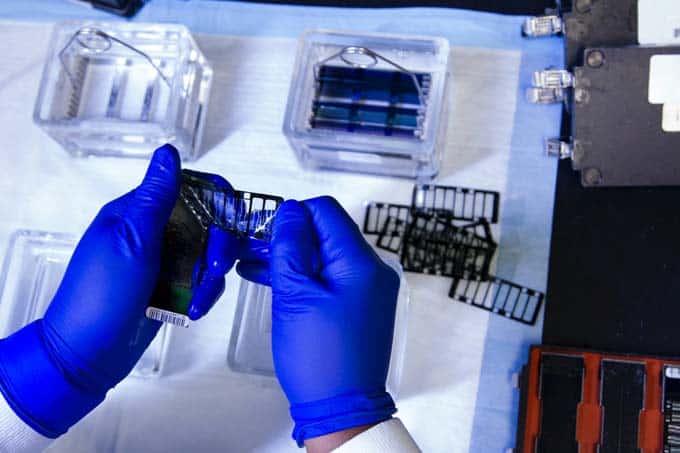Qualitätsmanagement-Lösungen für soziale Einrichtungen
Qualitätsmanagement im Sozialwesen ist ein Spannungsfeld zwischen dem Wunsch, hochwertige Dienstleistungen für Menschen anzubieten, und den oftmals sehr knappen Ressourcen in diesem Sektor. Innovative Softwarelösungen helfen Trägern sozialer Einrichtungen, Abläufe klarer zu strukturieren, Normvorgaben und Richtlinien abzubilden und einzuhalten sowie die Aufwände für Verwaltung und Dokumentation zu reduzieren.

Die Arbeit mit Menschen erfordert ein völlig anderes Qualitätsverständnis als im produzierenden Gewerbe. Soziale, kommunikative und zwischenmenschliche Ziele stehen im Vordergrund, gleichzeitig müssen soziale Einrichtungen aber auch betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Erfordernissen gerecht werden. Dabei unterstützt ein gut strukturiertes Qualitätsmanagementsystem soziale Dienstleister wie Lebenshilfen, Wohlfahrtsverbände, Träger von Kitas oder Betreiber anderer sozialer Einrichtungen.
Softwaregestütztes Qualitätsmanagement spart Zeit
Die Softwarelösungen wie jene des deutschen Softwareherstellers ConSense GmbH können einen Beitrag leisten, um Prozesse übersichtlicher und effizienter zu gestalten, Verantwortlichkeiten klar zu definieren und Dokumentationsvorgaben zu erfüllen. Gleichzeitig erleichtert das Managementsystem die Einhaltung der für die jeweilige Einrichtung geltenden Normen und Richtlinien. Die Softwarelösungen von ConSense sind nach Hersteller-Angaben mit einem besonderen Fokus auf Anwendungsfreundlichkeit und die Abbildung realitätsgetreuer Abläufe entwickelt worden. Auf der übersichtlichen Oberfläche können Mitarbeitende schnell und intuitiv navigieren, eine umfassende Suchfunktion leitet direkt zu gewünschten Inhalten.
Die QM-Software von ConSense ermöglicht eine komplette elektronische QM-Dokumentation mit automatisierter, intelligenter Dokumentenlenkung. Weitere Automatisierungen, wie die zielgerichtete Informationsverteilung, die Aufforderung zu Kenntnisnahmen und die Revisionierung und Archivierung von Dokumenten, reduzieren den Verwaltungsaufwand für die Beschäftigten deutlich. Gleichzeitig bietet die Software ein integriertes Prozessmanagement inklusive Prozesseditor zur einfachen und schnellen Prozessmodellierung. Das vereinfacht die kontinuierliche Verbesserung von Abläufen und die Transparenz und Übersichtlichkeit der Dokumentation nehmen zu.
QM-Software für soziale Einrichtungen mit vielen Standorten
Die hier erwähnten Softwarelösungen für Managementsysteme eignen sich nach Angaben des Herstellers für Organisationen jeder Grössenordnung. Mit einer Vielzahl von Funktionen, Schnittstellen und Konfigurationsmöglichkeiten würden sie sich optimal an die Bedürfnisse der jeweiligen Einrichtung anpassen lassen, wie es heisst. Die Lösung ConSense IMS ENTERPRISE eignet sich beispielsweise zum Aufbau eines Integrierten Managementsystems in Einrichtungen mit mehreren Standorten oder komplexen Organisationsstrukturen. Alle zutreffenden Normen und Regelwerke werden dabei systematisch unter einer einheitlichen Oberfläche abgebildet und die Einhaltung von Vorgaben unterstützt.
Neben der Qualitätsmanagementnorm DIN EN ISO 9001 sind im sozialen Sektor auch viele andere Normen oder Richtlinien relevant, beispielsweise DIN EN ISO 45001 (Arbeitsschutz), HACCP (Hygienekonzepte in Bezug auf Lebensmittel) oder DIN EN ISO 15224 (Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen). Die Lösungen für QM-Systeme und Integrierte Managementsysteme des Aachener Softwareentwicklers lassen sich zusätzlich durch Module, wie z. B. für Massnahmenmanagement, Auditmanagement, Schulungsmanagement und viele weitere, beliebig ergänzen und damit gezielt auf die Anforderungen der Organisation abstimmen.
Einfacher Roll-Out, mobile Bereitstellung
Die Softwarelösungen von ConSense lassen sich schnell und flexibel im Unternehmen einführen. Hierzu bietet auch die webbasierte Managementsystem-Lösung ConSense PORTAL, für die von ConSense auch das Hosting übernommen werden kann, Unterstützung. Die Webanwendung vereinfacht und beschleunigt den Roll-Out im Vergleich zu den Desktop-Anwendungen. Da sie auch mobil genutzt werden kann, eignet sie sich besonders für soziale Einrichtungen, deren Mitarbeitende zeit- und ortsunabhängig mit dem System arbeiten.
Weitere Informationen zu den hier beschriebenen Lösungen: ConSense GmbH, Aachen