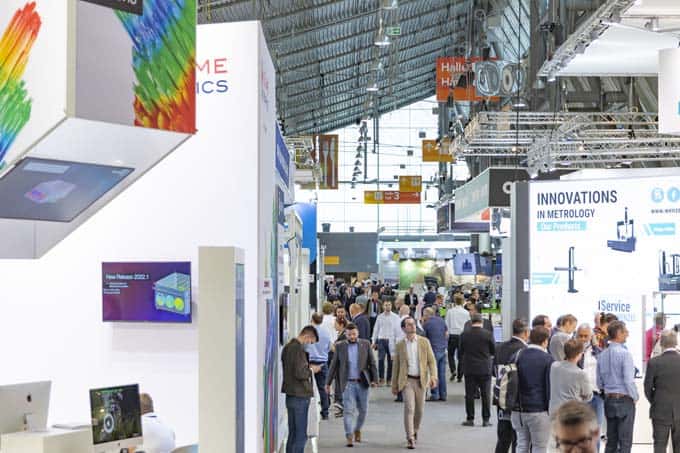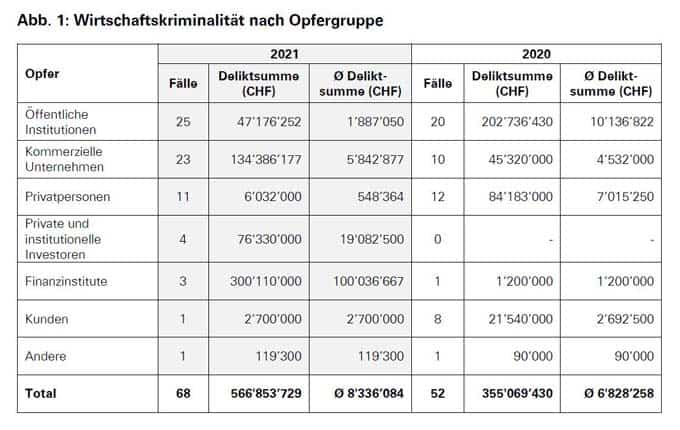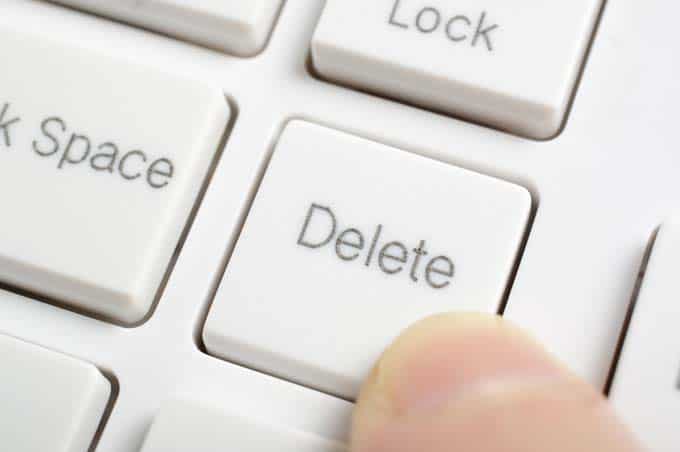Kundenfreundliche Servicekultur: 10 Tipps
Gute Unternehmen bieten einen guten Kundenservice. Top-Unternehmen dagegen machen ihn zum Teil ihrer DNA. Das ist nicht immer einfach. Doch mit gezielten Massnahmen lassen sich erstaunliche Erfolge für das Unternehmen, die Mitarbeitenden und – was am wichtigsten ist – für die Kundinnen und Kunden erzielen.

Wenn Sie als Führungskraft Ihren Kundenservice verbessern möchten, sollten Sie erst eine entsprechende Firmenkultur etablieren: ein ganzheitliches Konzept, bei dem die Menschen im Mittelpunkt der organisatorischen Abläufe stehen. Das ist nicht ganz einfach. Doch folgende zehn Tipps können Sie in Ihrem Vorhaben unterstützen.
1. Formulieren Sie ein Mission Statement
Ihr Mission Statement sollte die Grundwerte des Unternehmens im Hinblick auf die Kundenbetreuung widerspiegeln. Es sollte so kurz formuliert sein, dass es sich einprägt – doch auch lang genug, um aussagekräftig zu sein. Verfassen Sie Ihr Mission Statement verständlich und eindrücklich, so dass alle Angestellten die beabsichtigten Änderungen im Kern erfassen.
2. Entwickeln Sie ein Unternehmensleitbild
Nicht jedem ist bereits am ersten Tag der Firmengründung klar, wie ein guter Kundenservice aussieht. Dazu müssen Sie aktiv werden. Einfacher ist es für Ihr Personal, wenn sie sich an einem Unternehmensleitbild – einer längeren Variante Ihres Mission Statement – orientieren können. Formulieren Sie dieses Leitbild so prägnant, dass es auf eine Karte gedruckt und eingesteckt werden könnte.
3. Setzen Sie auf Eigenverantwortung
Damit ein Contact Center effizient arbeiten kann, sollten die Mitarbeiter ermächtigt sein zu handeln. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Vorgesetzten sie ausdrücklich darauf hinweisen und sie dabei unterstützen. Bringen Sie das Prinzip der Eigenverantwortung – auf Englisch „Empowerment“ – in Ihren Schulungen immer wieder zur Sprache und lassen sie es von den Führungskräften bestätigen. Demonstrieren Sie diese Einstellung, indem Sie Angestellte, die Initiative zeigen, auszeichnen und belohnen.
Damit Empowerment nicht nur ein Lippenbekenntnis bleibt, müssen Sie eines klar vermitteln: Jeder Mitarbeiter hat (natürlich erst nach einer gewissen Einarbeitungszeit) das Recht, eigene Entscheidungen zu treffen, auch wenn sie sich als kostspielig erweisen. Das ist ein wichtiger Teil des Lernprozesses und der wichtigste operative Punkt, auf den Sie sich bei der Schaffung einer Servicekultur konzentrieren müssen.
4. Betrachten Sie die Persönlichkeit als wichtigstes Einstellungskriterium
Um es kurz zu halten: Legen Sie bei den Bewerbungsgesprächen mehr Gewicht auf bestimmte Persönlichkeitsmerkmale des Kandidaten als auf seine Erfahrung (trotzdem sollte Berufserfahrung natürlich gewürdigt und berücksichtigt werden).
Achten Sie bei der Erstellung der Dienstpläne auf wirklich dienstleistungsorientierte Angestellte und geben Sie ihnen die nötigen Werkzeuge an die Hand, damit sie handlungsfähig sind. Denn die Frontline-Manager gehören zu den wichtigsten Akteuren bei Aufbau und Pflege einer optimalen Kundenservicekultur.
5. Beziehen Sie die Führungskräfte in Ihr Onboarding ein
Um eine Servicekultur zu etablieren, sollten Sie den CEO oder das Management direkt in die Schulung einbeziehen. Es gibt nichts Wirkungsvolleres als die Anwesenheit von Führungskräften, wenn Sie zeigen wollen, dass Ihr Unternehmen Kundenservice ernst nimmt. Auf diese Weise demonstrieren Sie, dass die Leitung ein direktes Interesse an den Leistungs- und Erfolgsmöglichkeiten der Kundenservicemitarbeiter hat. Außerdem werden Mission Statement und Firmenleitbild damit von Anfang an durch die Führungsebene vermittelt.
6. Starten Sie jede Schicht mit einem Standup-Meeting
Ob Sie es Daily Huddle, Standup-Meeting oder Teambesprechung nennen – eine Rekapitulierung der wichtigsten Servicegrundsätze zu Schichtbeginn ist optimal, um die Beschäftigten auf den Tag einzustimmen. Dieses Ritual kann zum Katalysator Ihrer Servicekultur werden, insbesondere dann, wenn die Mitarbeiter das Meeting im Wechsel leiten dürfen. Zum einen dient es dem direkten Austausch und der Festigung von Fachwissen in der gesamten Gruppe; zum anderen bietet es den Angestellten die Chance, Führungsqualitäten zu entwickeln.
Um Strategien zur Serviceoptimierung im ganzen Unternehmen zu etablieren, eignet sich die tägliche Erinnerung an die Prinzipien des Kundenservices hervorragend. Sie fördert das Zusammengehörigkeitsgefühl und die Arbeitsmoral derjenigen, von denen der Erfolg unmittelbar abhängt: die Agenten, die im direkten Kontakt mit dem Kunden stehen.
7. Vermeiden Sie mitarbeiterfernes Management
Mitarbeiternähe ist ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Schaffung einer Kundenservicekultur. Versteckt sich ein Manager in seinem Büro, verpasst er unzählige Gelegenheiten, sein Team und die Servicekultur zu unterstützen. Und damit wären wir wieder bei den Einstellungskriterien: Stellen Sie sicher, dass die richtigen Leute an den richtigen Positionen sitzen. So sorgen Sie dafür, dass Ihre Führungskräfte ansprechbar sind und gerne helfen.
8. Überarbeiten Sie Ihre Kundenservice-Schulungen
Schulungen gelten nicht unbedingt als relevant für die Unternehmenskultur. Doch auf eine Kundenservicekultur trifft das nicht zu. Servicemitarbeiter sollten unbedingt die Regeln, Prozesse und Touchpoints kennenlernen, aus denen ihr Tagesgeschäft besteht. Machen Sie Ihnen die vielfältigen Möglichkeiten bewusst die Ihr Unternehmen bietet, um dem Kunden gerecht zu werden. Wer sich die Zeit nimmt, Top-Bewerber auszuwählen, sollte auch in die optimale Schulung investieren.
9. Eliminieren Sie das Zuständigkeitsdenken
„Nicht meine Aufgabe“ – Solche Sätze aus den Köpfen von Angestellten und Führungskräften zu verbannen, muss für jedes Unternehmen mit Kundenservice-Ambitionen ein Anliegen sein. Jeder sollte bereit sein, in Spitzenzeiten mit anzupacken.
Ein lateraler Ansatz löst praktische Probleme, steigert die Arbeitsmoral und zeigt allen Mitarbeitern ganz deutlich, dass jeder im Unternehmen auf das gleiche, gemeinsame Ziel hinarbeitet.
10. Fördern Sie das gemeinschaftliche Denken
Ermuntern Sie alle Abteilungen, bei einer Kundenservice-Panne gemeinsam nach den Gründen und nach Wegen zu suchen, diese künftig zu vermeiden. Das führt nicht nur zu besseren Ergebnissen, sondern kommt auch der Unternehmenskultur zugute – denn es zeigt, was in Ihrem Betrieb wertgeschätzt wird. Denken Sie daran: Verantwortliches Handeln und das ernsthafte Bemühen, aus vergangenen Fehlern zu lernen, sind die Grundpfeiler jeder Kundenservicekultur.
Wenn Sie diese zehn Ratschläge beherzigen, sind Sie auf dem besten Weg zu einer Servicekultur, von der Ihr Unternehmen und Ihre Kunden dauerhaft profitieren.
Autor:
David Evans ist Head of Product Management bei Vonage. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Innovative Software und über 12 Jahre Erfahrung im Produktmanagement. Mit seinem Team bei Vonage verfolgt Evans bei der Entwicklung von Produkten einen kundenzentrierten Ansatz und sucht immer nach neuen Möglichkeiten, wie Marken mit ihren Kunden in Kontakt treten können, um deren Loyalität und Wachstum zu fördern.